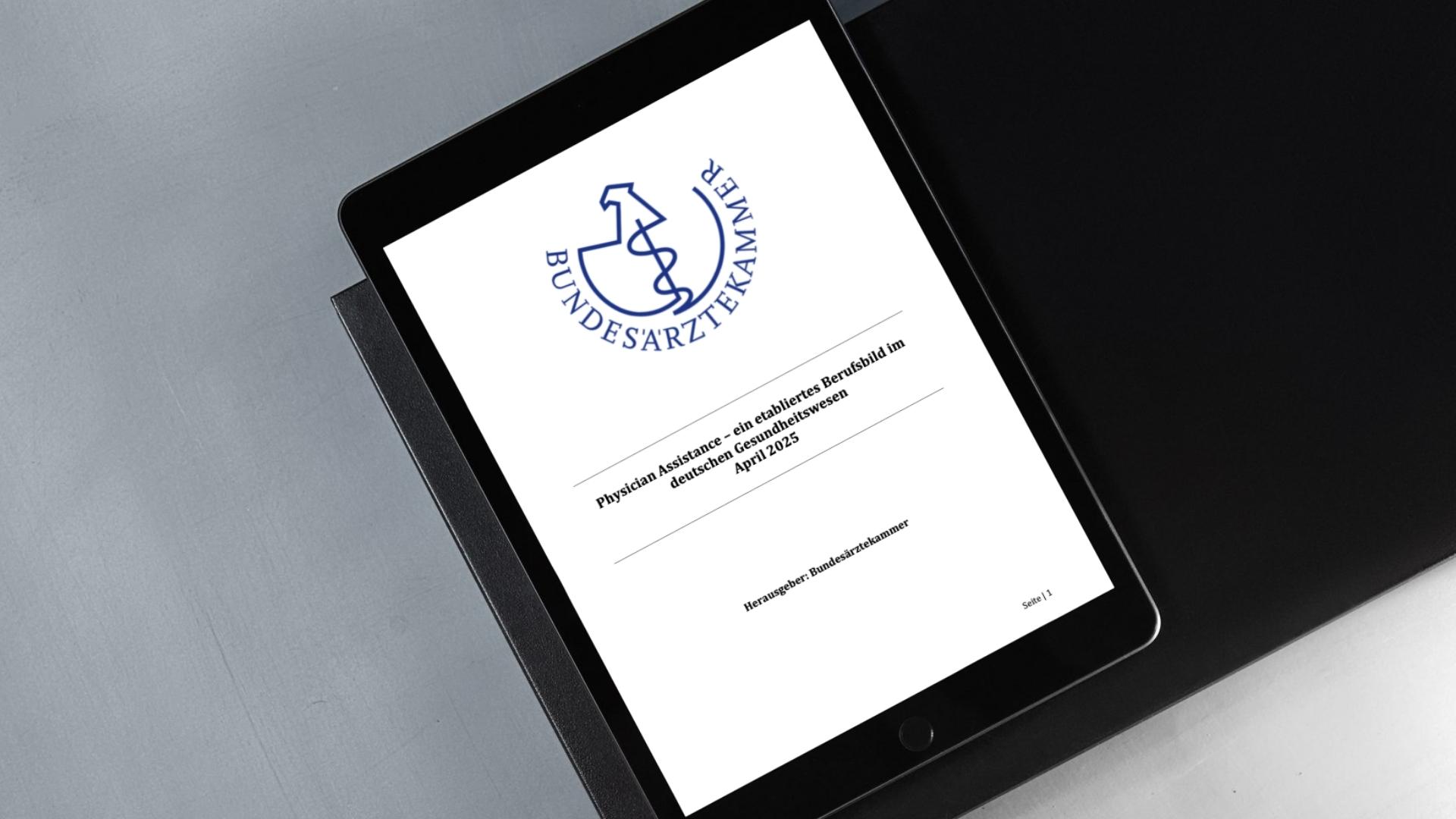Seit eineinhalb Jahren hat die Deutsche Gesellschaft für Physician Assistants e.V. (DGPA) intensiv an dem neuen Positionspapier der Bundesärztekammer (BÄK) mitgearbeitet. In enger Abstimmung mit Vertreterinnen und Vertretern der ärztlichen Selbstverwaltung brachte die DGPA die Perspektive der Berufsangehörigen ein und wirkte maßgeblich an der fachlichen Ausgestaltung mit. Nun liegt das lang erwartete Papier vor: „Physician Assistance – ein etabliertes Berufsbild im deutschen Gesundheitswesen“ (02.05.2025). Das neue Positionspapier markiert einen weiteren Schritt in der Entwicklung des PA-Berufs und ersetzt die frühere Fassung aus dem Jahr 2017. Während die damalige Version den Physician Assistant (PA) als einen neuen, delegierten Assistenzberuf im Gesundheitswesen positionierte, bringt das aktuelle Positionspapier mehr Klarheit, Struktur und Professionalisierung.
Doch welche konkreten Neuerungen bringt die neue Fassung? Welche Unterschiede gibt es im Vergleich zur 2017er-Stellungnahme? Und was bedeutet das für die Zukunft des Berufsbildes in Deutschland?
Die wichtigsten Neuerungen im Überblick
Das neue Positionspapier bringt vier zentrale Veränderungen in der Bewertung und Empfehlung des PA-Berufs mit sich.
Zum einen empfehlen die Institutionen erstmals ein dreistufiges Kompetenzmodell, das die Arbeit von Physician Assistants differenziert nach Grund-, erweiterten und speziellen Kompetenzen beschreibt. Damit wird eine fachlich fundierte Struktur für mögliche Weiterentwicklungen und Spezialisierungen geschaffen, auch wenn die rechtliche Umsetzung noch aussteht.
Wichtig ist dabei: Das Modell versteht sich als wachsendes, individuelles Kompetenzraster – es soll als „Living Document“ fungieren, das PAs mit wachsender Berufserfahrung eine stufenweise Entwicklung ermöglicht.
Ein weiterer wesentlicher Punkt ist die positive Positionierung der PAs im ambulanten Bereich. Während die Stellungnahme von 2017 den Fokus auf die stationäre Versorgung legte, spricht sich die BÄK nun explizit für den Einsatz von PAs auch in der ambulanten Medizin aus – etwa in Hausarztpraxen, Reha-Zentren oder medizinischen Versorgungszentren (MVZs). Dies stellt eine wichtige fachliche Weichenstellung dar, auch wenn es für viele Settings noch keine konkreten Umsetzungsregelungen gibt.
Auch im Bereich der Ausbildung enthält das Positionspapier neue empfohlene Standards: So unterstützt die BÄK nun explizit die Möglichkeit, das PA-Studium auch primärqualifizierend – also direkt nach dem Abitur – zu absolvieren. Zudem wird empfohlen, dass mindestens 25 % der ECTS-Punkte in einem klinischen Setting stattfinden sollen. Dies ist ein deutliches Zeichen für die notwendige Praxisnähe des Studiums.
Gleichzeitig lehnt die BÄK ausdrücklich Fernstudiengänge ohne ausreichende praktische Anteile ab. Ein PA-Abschluss aus einem solchen Fernstudiengang wird nicht anerkannt. Bestehende Studiengänge sollen innerhalb von 36 Monaten reakkreditiert werden – auch unter Aufsicht der jeweiligen Landesärztekammern.
Darüber hinaus differenziert das Papier klar zwischen primär- und sekundärqualifizierendem Studium: Während der direkte Zugang nach dem Abitur (primärqualifizierend) möglich sein soll, bleibt der bisherige Weg über eine vorausgehende Ausbildung im Gesundheitswesen (sekundärqualifizierend) weiterhin zentral. Entsprechend unterscheiden sich auch Umfang und Anforderungen, etwa durch zusätzliche Module oder ein verpflichtendes Pflegepraktikum im primärqualifizierenden Studium.
Schließlich geht die BÄK in ihrem Positionspapier erstmals konkret auf die Ausgestaltung eines bundeseinheitlich geregelten Abschlusses des PA-Studiums ein. Das Studium „Physician Assistance“ sollte demnach künftig mit einer bundesweit einheitlichen Prüfung – zusätzlich zur Bachelorarbeit – abgeschlossen werden. Dafür sei eine bundeseinheitlich geregelte Ausbildungsordnung erforderlich.
Die Abschlussprüfung sollte sich aus drei Teilen zusammensetzen: einem schriftlichen, einem mündlichen und einem praktischen Prüfungsteil. Der schriftliche Teil soll an drei aufeinanderfolgenden Tagen stattfinden und jeweils 120-minütige Klausuren umfassen.
Tag 1: Abfrage medizinischer Grundlagen mit Fokus auf Anatomie, Physiologie und Pathophysiologie
Tag 2: Themen der klinischen Diagnostik und Therapie wie Differentialdiagnosen, Notfallmedizin und Pharmakologie
Tag 3: Spezielle Inhalte wie rechtliche Grundlagen, Berufsrolle und evidenzbasierte Medizin
Der mündliche Teil besteht aus einer 15-minütigen strukturierten Fallpräsentation eines Patienten, gefolgt von 15 Minuten vertiefenden Fragen zur klinischen Entscheidungsfindung.
Im praktischen Prüfungsteil sollen die Prüflinge ihr Können in realitätsnahen Szenarien demonstrieren – z. B. in der Notaufnahme oder im stationären Alltag. Dabei stehen klinisches Handeln, Kommunikation und professionelles Auftreten im Fokus.
Zusätzlich neu: Die BÄK spricht sich klar für Masterstudiengänge zur weiteren Professionalisierung aus. Diese sollen eine vertiefte fachliche Spezialisierung ermöglichen, zum Beispiel in Notfall- und Intensivmedizin, Pädiatrie oder auch in Lehre, Forschung und Managementfunktionen. Damit wird die Entwicklungslinie des PA-Berufs nicht nur in die Breite, sondern auch in die Tiefe geöffnet.
Was bedeutet das für die Zukunft des Berufs?
Das neue Positionspapier ist ein bedeutender Meilenstein für den Physician Assistant in Deutschland. Zum ersten Mal wird ein klarer Entwicklungsweg aufgezeigt, der nicht nur das Studium und die Einsatzmöglichkeiten, sondern auch langfristige Karrierewege und Spezialisierungen umfasst.
Mit der breiteren Anerkennung des PA in der ambulanten Medizin und der Debatte um eine gesetzliche Regelung könnte sich der Beruf in den kommenden Jahren noch weiter etablieren. Dies wäre insbesondere mit Blick auf den anhaltenden Ärztemangel in Deutschland ein entscheidender Fortschritt.
Kein gemeinsames Papier mit der KBV – ein bemerkenswerter Punkt
Obwohl die KBV in der Vergangenheit häufig in gemeinsame Stellungnahmen eingebunden war, ist sie nicht Mit-Herausgeber dieses aktuellen Papiers. Das Papier wurde ausschließlich von der Bundesärztekammer veröffentlicht.
Diese Entscheidung wirft Fragen auf – etwa zur zukünftigen Rolle der KBV bei der konkreten Umsetzung in der ambulanten Versorgung, wo sie eine zentrale Stellung einnimmt. Eine offizielle Begründung für ihr Fehlen wurde bislang nicht veröffentlicht.
Ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung
Das neue Positionspapier der Bundesärztekammer stellt einen wichtigen Fortschritt dar und sorgt für dringend benötigte Klarheit und Struktur im PA-Beruf. Besonders das dreistufige Kompetenzmodell und die Einbeziehung der ambulanten Versorgung sind zentrale Neuerungen, die den Physician Assistant in Deutschland langfristig stärken könnten.
Jedoch bleiben einige Fragen offen: Wie konkret wird die gesetzliche Regelung ausgestaltet? Welche Rolle wird die Bundesärztekammer in der praktischen Umsetzung einnehmen? Wie werden die neuen Ausbildungsstandards in die Praxis überführt und kontrolliert?
Fest steht: Die Physician Assistants haben einen festen Platz im deutschen Gesundheitswesen gefunden. Das neue Positionspapier könnte nun den entscheidenden Impuls für eine noch stärkere Integration des Berufsbildes geben.