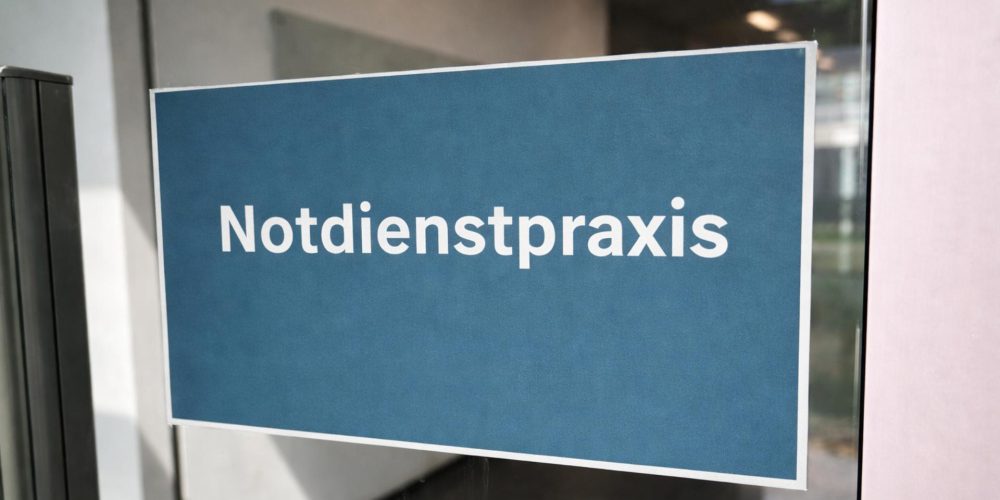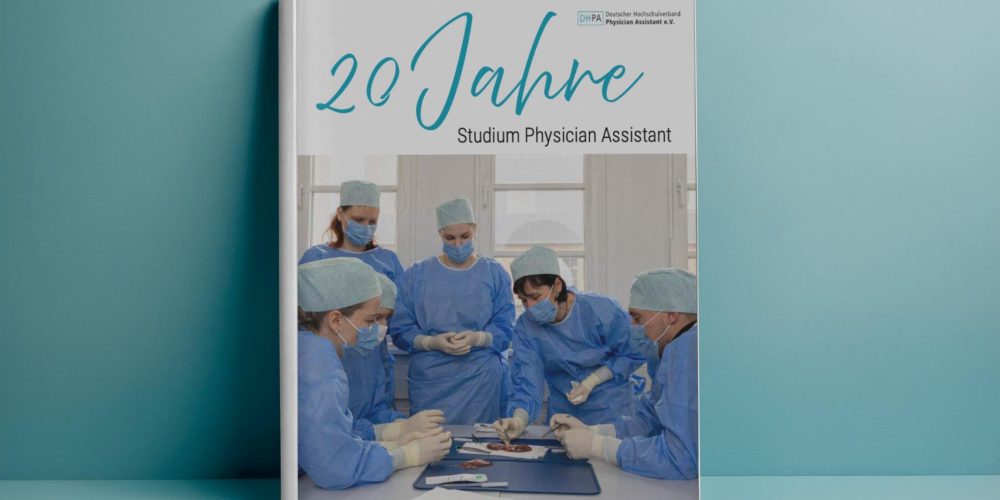Der Physician Assistant rückt zunehmend in den Fokus berufspolitischer und praktischer Diskussionen. Beim diesjährigen Symposium der Internationalen Studien- und Berufsakademie (ISBA) am Standort Münster wurde deutlich: Die Profession ist im Wandel und mittendrin in der Suche nach klaren Strukturen, politischer Anerkennung und flächendeckender Versorgungslösungen.
Die ISBA gehört mittlerweile zu den größten Anbietern für PA-Studiengänge in Deutschland. Mit Standorten in Erfurt, Heidelberg, München und Münster bereits etabliert, erweitert die Akademie ihr Angebot auf Saarbrücken, Stuttgart und Leipzig. Damit soll die wohnortnahe akademische Qualifikation von PAs weiter gestärkt und dem steigenden Fachkräftebedarf begegnet werden.
Eröffnung und Begrüßung
Eröffnet wurde die Veranstaltung von Prof. Dr. Marcus Hoffmann, der einen kurzen Rückblick auf die Entwicklung des PA-Studiengangs an der ISBA gab und auf das kürzlich veröffentlichte Positionspapier der Bundesärztekammer (BÄK) einging. Das Dokument wurde im Mai 2025 verabschiedet und markiert eine Weiterentwicklung des Papiers aus dem Jahr 2017.
Prof. Dr. Barbara Puhahn-Schmeiser, Studiengangsleiterin am Standort Münster, sowie Prof. Dr. Herbert A. Zeuner, wissenschaftlicher Leiter des Studiengangs Physician Assistant, begrüßten die Teilnehmenden offiziell und betonten die zunehmende Rolle von PAs in der Gesundheitsversorgung sowie die wachsende Bedeutung des Münsteraner Standorts.
Das BÄK-Positionspapier im Fokus
Dr. Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer, beleuchtete in seinem Vortrag die Entstehung und Inhalte des neuen Positionspapiers. Er machte deutlich:
- Das Papier versteht sich als „Living Document“, das kontinuierlich weiterentwickelt werden soll.
- Es formuliert klarere Tätigkeitsprofile und Verantwortlichkeiten für PAs als die frühere Version.
- Der Unterschied zwischen Delegation und Substitution wurde ausführlich diskutiert: Bei der Delegation verbleibt die Verantwortung beim Arzt, bei der Substitution würde sie auf den Ausführenden übergehen – Letzteres ist laut Papier nicht vorgesehen.
- Auch Haftungsfragen wurden angesprochen – die ärztliche Verantwortung bleibt bestehen, ähnlich wie bei medizinischen Fachangestellten.
Reinhardt betonte zudem, dass man aus den Entwicklungen in Ländern wie den USA und Großbritannien lernen müsse, wo Konkurrenzsituationen zwischen Ärzten und PAs entstanden sind. Ziel in Deutschland sei ein kooperativer Teamansatz.
Zu den offenen Fragen gehören:
- die Frage einer möglichen Kammerzugehörigkeit,
- die staatliche Anerkennung des Berufsbilds,
- sowie Anpassungen im Bundesmantelvertrag, um delegierbare Leistungen klar zu regeln.
Hochschulische Perspektiven
Prof. Dr. Peter Heistermann, Vorsitzender des Deutschen Hochschulverbands für Physician Assistants (DHPA), ordnete das Papier aus Sicht der Hochschulen ein: Zwar sei es ein wichtiger Impuls, doch stelle sich die Frage, wie eine bundeseinheitliche Abschlussprüfung realistisch eingeführt und finanziert werden könne. Auch die curricularen Anpassungen seien aufwendig und derzeit nur auf freiwilliger Basis umsetzbar, die BÄK habe keine Weisungsbefugnis gegenüber den Hochschulen. Heistermann warb dafür, den Blick auch auf andere Gesundheitsberufe zu richten, die in der Vergangenheit erfolgreich Sichtbarkeit und politische Strukturen aufgebaut hätten.
Versorgung in der Praxis: Ein Modell aus Papenburg
Ein eindrucksvolles Praxisbeispiel lieferte Dr. Volker Eissing, Hausarzt aus Papenburg. In seiner ländlichen Praxis versorgen nur wenige Hausärzte gemeinsam mit einem Team aus PAs, MFAs und anderen Gesundheitsberufen eine ganze Region. Der Schlüssel liege in einer Kombination aus Delegation, PAs mit spezifischen Aufgabenprofilen und dem Einsatz von digitalen Hilfsmitteln wie KI. Eissing zeigte, dass PAs längst unverzichtbar sind, gerade in strukturschwachen Regionen.
Fazit: PA-Beruf zwischen Umsetzung und Weiterentwicklung
Das Symposium war eine gelungene Mischung aus berufspolitischer Einordnung und praktischen Einblicken. Es wurde deutlich, dass Physician Assistants bereits heute einen wichtigen Beitrag zur Patientenversorgung leisten – in Kliniken, Praxen und zunehmend auch interprofessionellen Versorgungsmodellen. Gleichzeitig braucht es politischen Willen, klare gesetzliche Rahmenbedingungen und die Bereitschaft zur Weiterentwicklung der Ausbildung, damit das Berufsbild nachhaltig verankert werden kann.
Siehe Dir hier die PA Hochschulfinderprofile ISBA Stuttgart an,