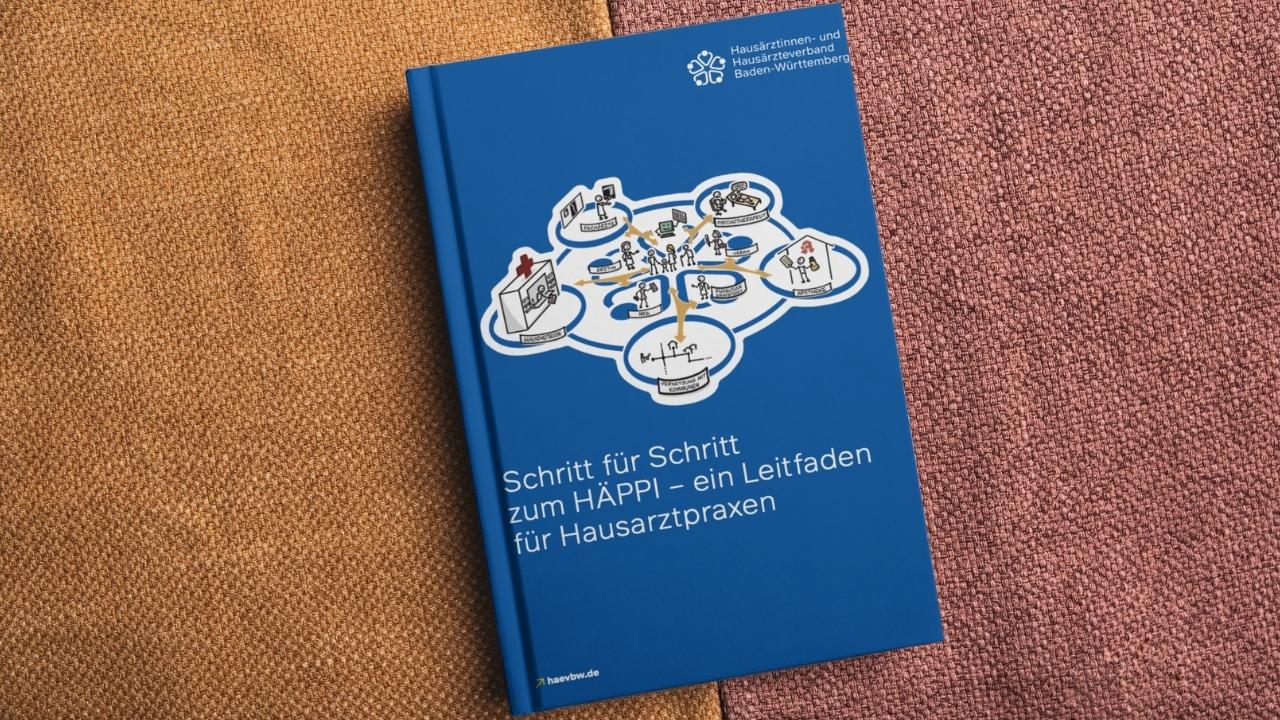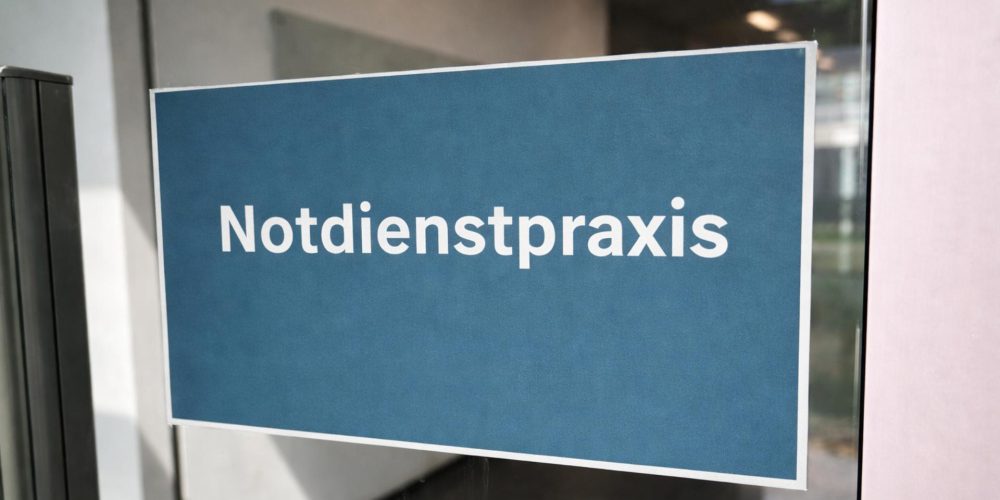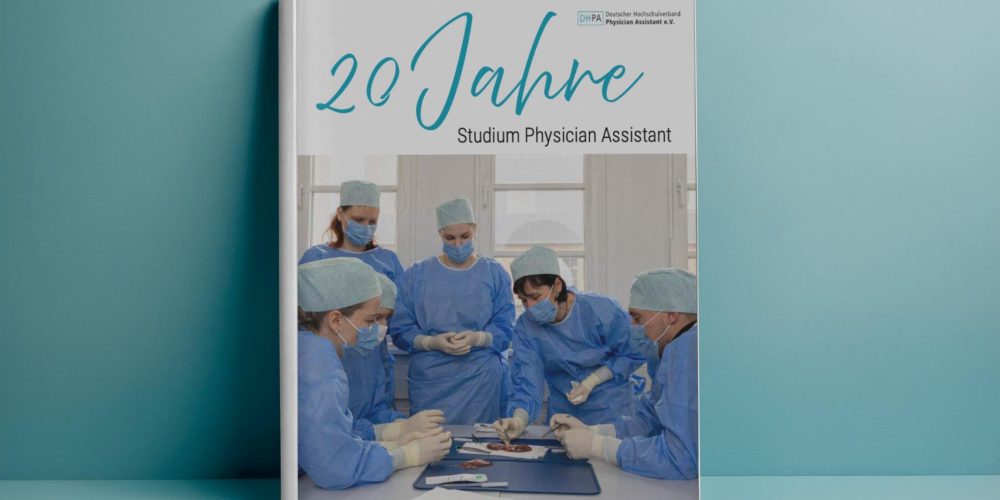Der Fachkräftemangel und die steigenden Anforderungen an die hausärztliche Versorgung machen innovative Konzepte erforderlich. Das HÄPPI-Projekt (Hausärztliches Primärversorgungszentrum – Patientenversorgung Interprofessionell) des Hausärztinnen- und Hausärzteverbands Baden-Württemberg bietet genau hierfür eine Lösung: eine teamorientierte Hausarztpraxis mit klar definierten Rollen, digitaler Unterstützung und neuen Delegationsmodellen. Dabei spielt der Physician Assistant (PA) eine zentrale Rolle.
Bereits zum Start des Projekts haben wir über die Ziele und Ansätze des HÄPPI-Modells berichtet.
Die Ergebnisse des HÄPPI-Projekts wurden nun am 14. März auf dem 23. Baden-Württembergischen Hausärztinnen- und Hausärztetag in Stuttgart vorgestellt. Die Präsentation zeigte, wie durch den gezielten Einsatz von PAs eine spürbare Entlastung der Hausarztpraxen erreicht werden kann. Expert:innen und Teilnehmende diskutierten die Potenziale der interprofessionellen Zusammenarbeit und die zukünftigen Schritte zur weiteren Implementierung dieses Modells in der hausärztlichen Versorgung.
Die Rolle des Physician Assistants im HÄPPI-Modell
Im Rahmen der Pilotierung wurde untersucht, wie sich PAs optimal in die Versorgung integrieren lassen. Das Ergebnis: Die gezielte Delegation an PAs erhöht die Effizienz, verbessert die Patientenversorgung und entlastet Hausärzt:innen signifikant. In den Pilotpraxen übernahmen PAs u. a. die strukturierte Anamnese, klinische Untersuchungen und die Betreuung chronisch Erkrankter. Zudem führten sie Hausbesuche durch und koordinierten digitale Sprechstunden.
Ein herausragendes Beispiel ist die Implementierung der PA-Sprechstunde, die sich besonders in Akut- und Chronikerfällen bewährt hat. Patienten mit unkomplizierten Infekten oder stabilen chronischen Erkrankungen konnten direkt von den PAs betreut werden. Dadurch gewannen Hausärzt:innen wertvolle Zeit für komplexe Fälle.
Konkrete Ergebnisse zur Delegation an PAs
- Assistierte Sprechstunde: In den Pilotpraxen führten PAs bis zu 25 % aller Sprechstunden durch. Hierbei übernahmen sie die Betreuung von Patienten mit Erkältungskrankheiten, Harnwegsinfektionen und Hautausschlägen. Nach festgelegten SOPs (Standard Operating Procedures) konnten sie selbstständig Diagnostik und Therapie einleiten, wobei sie in 20-30 % der Fälle eine ärztliche Rücksprache hielten.
- Haus- und Heimbesuche: In mehreren Pilotpraxen führten PAs eigenständig Hausbesuche bei stabilen, chronisch erkrankten Patient:innen durch. Dazu gehörte die Wundversorgung, Medikationsanpassungen in Rücksprache mit dem Arzt sowie die Betreuung von geriatrischen Patienten.
- Digital unterstützte Delegation: In einer Praxis konnten PAs durch den Einsatz von Videokonsultationen bis zu 15 % der Routinefälle eigenständig lösen, indem sie Patient:innen in der digitalen Sprechstunde berieten und bei Bedarf an die Hausärzt:innen weiterleiteten.
- Notfallversorgung: Einige Praxen integrierten PAs in die Akutversorgung, sodass sie Patienten in der Triage und Erstversorgung unterstützen konnten. Durch dieses Modell wurden Hausärzt:innen von weniger komplexen Fällen entlastet und konnten sich stärker auf schwerwiegendere Diagnosen konzentrieren.
Effizientere Abläufe durch digitale Anwendungen
Die HÄPPI-Pilotpraxen setzten verstärkt auf digitale Werkzeuge zur Prozessoptimierung. Dazu gehörten KI-gestützte Telefonassistenten, Online-Terminbuchung und Messenger-Dienste zur internen Kommunikation. Besonders vorteilhaft war die Verknüpfung mit Videosprechstunden: PAs konnten so Patienten in Pflegeheimen oder im häuslichen Umfeld digital betreuen und flexibel mit dem ärztlichen Team Rücksprache halten.
Best Practices: Erfahrungen aus den Pilotpraxen
- Delegation durch klare Rollenverteilung: PAs übernahmen definierte Aufgabenbereiche, darunter die assistierte Sprechstunde und Hausbesuche.
- Digitale Integration: Praxissoftware und Messenger erleichterten den internen Austausch und verkürzten Entscheidungswege.
- Strukturierte Teamarbeit: Regelmäßige Fallbesprechungen und Supervision durch Hausärzt:innen sicherten die Qualität der PA-Arbeit.
Fazit: Mehr Zeit für Patienten, weniger Belastung für Hausärzt:innen
Die Ergebnisse des HÄPPI-Projekts zeigen, dass PAs eine entscheidende Rolle in der zukunftsfähigen hausärztlichen Versorgung spielen. Durch eine sinnvolle Delegation ärztlicher Aufgaben, kombiniert mit digitaler Unterstützung, kann die Versorgung effizienter und patientenorientierter gestaltet werden. Die Pilotpraxen ziehen ein positives Fazit: Kürzere Wartezeiten, bessere Patientenbetreuung und eine höhere Zufriedenheit im Team sind klare Vorteile des HÄPPI-Modells.
Das Projekt ist nun offiziell abgeschlossen, doch die Implementierung von PAs und deren Nutzen im Rahmen der Hausarztzentrierten Versorgung (HZV) bietet weiterhin hervorragende Rahmenbedingungen. Nun gilt es, mit den beteiligten Krankenkassen in Verhandlungen zu treten, um die erzielten Ergebnisse in die Regelversorgung zu überführen und das Konzept langfristig in der hausärztlichen Praxis zu etablieren.
Sie möchten mehr zu Physician Assistants in der hausärztlichen Versorgung erfahren? Hier finden Sie unser Whitepaper zur ambulanten Versorgung.