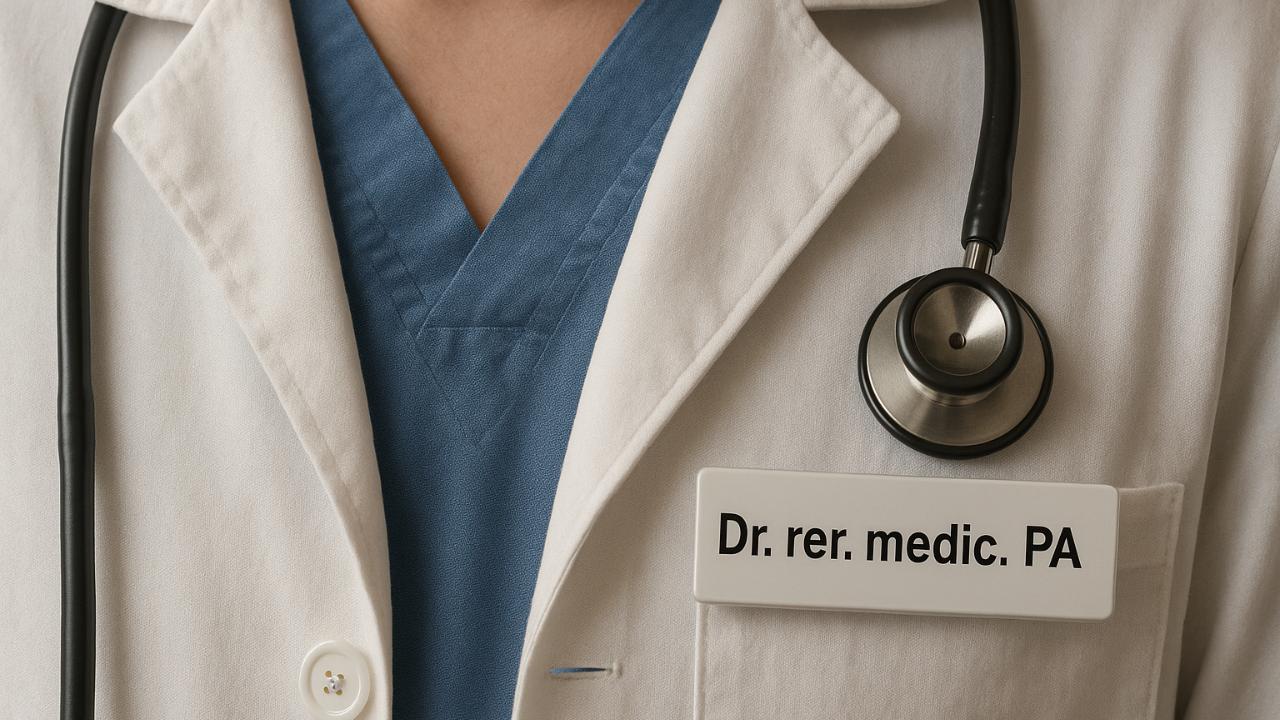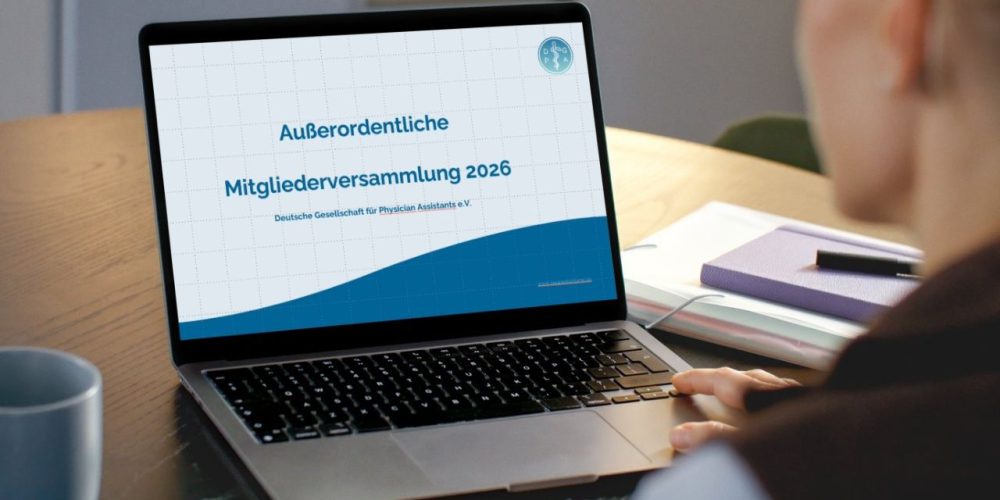Die Frage, ob Physician Assistants promovieren können, begegnet uns auf dem PA Blog regelmäßig, ob in persönlichen Nachrichten von Studierenden, im Kontext von Masterprogrammen oder bei Diskussionen rund um die akademische Weiterentwicklung des Berufsbildes. Nicht selten wirkt es auf den ersten Blick so, als sei der Weg zur Promotion nach einem PA-Masterabschluss ganz selbstverständlich möglich. Manche Hochschulen formulieren es in ihren Beschreibungen sogar so, als sei die Promotion der nächste logische Schritt im Anschluss an das Studium. Doch wie realistisch ist dieses Bild tatsächlich?
Die Antwort ist differenziert: Ja, in der Theorie ist eine Promotion für Physician Assistants möglich und es gibt auch bereits erste PAs, die diesen Schritt erfolgreich gegangen sind. Doch in der Praxis sieht die Realität für die meisten anders aus. Die strukturellen, institutionellen und beruflichen Hürden sind groß – so groß, dass der Weg zur Promotion für viele PA-Absolvent:innen eher die Ausnahme als die Regel bleibt.
Vom Master zur Promotion – was formal möglich ist
Grundsätzlich gilt: Wer über einen anerkannten Masterabschluss verfügt, kann sich in Deutschland auf eine Promotion bewerben. Physician Assistants, die ihr Masterstudium abgeschlossen haben – etwa in Palliative Care, Medizinpädagogik oder einem PA-Master – erfüllen damit formal die Voraussetzungen, um ein Promotionsverfahren an einer Universität zu beginnen. Die meistgewählte Promotionsform für nicht-ärztliche Gesundheitsberufe ist der Doctor rerum medicarum (Dr. rer. medic.), ein Titel, der typischerweise im Bereich der medizinischen Forschung vergeben wird, insbesondere für interdisziplinäre oder angewandte Gesundheitswissenschaften.
Doch dieser theoretische Zugang bedeutet nicht, dass der Weg in die Forschung automatisch offensteht. Denn: Promotionsverfahren finden ausschließlich an Universitäten statt und die Mehrheit der PA-Studiengänge ist derzeit an Fachhochschulen (Hochschulen für angewandte Wissenschaften) angesiedelt. Diese sind zwar akademisch anerkannt und qualitätsgesichert, verfügen jedoch nicht über das Promotionsrecht.
Das bedeutet konkret: Ein PA mit Masterabschluss muss sich aktiv um einen Promotionsplatz an einer Universität bemühen – entweder über den direkten Kontakt zu einem forschungsnahen Lehrstuhl oder über strukturierte Promotionsprogramme, etwa an Universitätskliniken. Der Weg dorthin ist jedoch alles andere als einfach.
Konkurrenz und Zugangshürden
Ein wesentlicher Engpass liegt in der Struktur des deutschen Wissenschaftssystems. Promotionsplätze sind knapp – insbesondere im Bereich der Gesundheitswissenschaften. Lehrstühle, die Promotionsverfahren im Bereich der Gesundheitsberufe anbieten, erhalten zahlreiche Bewerbungen. Neben PAs bewerben sich auch Absolvent:innen aus Public Health, Gesundheitsökonomie, Pflegewissenschaft oder Medizinpädagogik. Viele dieser Studiengänge sind seit Jahren forschungsnah aufgestellt und verfügen über etablierte Netzwerke in die universitäre Forschung.
Universitäten neigen dazu, ihre eigenen Absolvent:innen zu bevorzugen – insbesondere, wenn diese bereits als wissenschaftliche Mitarbeitende am Lehrstuhl tätig sind. Dies bringt einen weiteren entscheidenden Punkt ins Spiel: Für viele Promotionsverfahren ist eine mehrjährige Anstellung am Lehrstuhl faktisch Voraussetzung – nicht nur, um das Forschungsprojekt durchzuführen, sondern auch, um aktiv in Lehre, Projektarbeit und akademische Strukturen eingebunden zu sein. Für Physician Assistants, die meist klinisch in Vollzeit tätig sind, stellt dies eine massive Hürde dar. Die Vereinbarkeit von Forschung und Klinikalltag ist selten gegeben und alternative Modelle fehlen bislang weitgehend.
Promotionsversuche im Praxisalltag: Zwischen Ideal und Abbruch
Selbst wenn ein PA einen passenden Betreuer oder ein strukturiertes Promotionsprogramm findet, ist der Weg zur Dissertation lang und nicht ohne Risiken. Promotionsprojekte im Bereich Dr. rer. medic. dauern in der Regel mehrere Jahre und erfordern sowohl Zeit für die Datenerhebung und Analyse als auch für das wissenschaftliche Schreiben. Parallel dazu läuft der klinische Alltag weiter – ein Alltag, der oft wenig Raum für wissenschaftliches Arbeiten lässt.
Hinzu kommt: Viele Promotionsprojekte scheitern nicht an mangelndem Interesse oder Kompetenz, sondern an äußeren Umständen. Klinikwechsel, Veränderungen in der Abteilungsleitung, fehlende Betreuungsstrukturen oder der Weggang der Doktormutter bzw. des Doktorvaters führen dazu, dass die Dissertation nicht abgeschlossen werden kann. Insbesondere Physician Assistants, die in hochdynamischen Arbeitsfeldern wie der Notaufnahme, Inneren Medizin oder Allgemeinmedizin tätig sind, berichten immer wieder von Schwierigkeiten, wissenschaftliche Projekte langfristig durchzuhalten – schlicht, weil der Praxisbetrieb es nicht zulässt.
Strukturelle Perspektiven fehlen (noch)
Die aktuelle Lage zeigt: Es fehlt an systematischen Wegen für Physician Assistants, die eine wissenschaftliche Karriere anstreben. Kooperationen zwischen PA-Hochschulen und Universitäten sind selten. Promotionsprogramme, die gezielt für klinisch tätige Gesundheitsberufe offenstehen, existieren in Einzelfällen – flächendeckend jedoch nicht. Auch gibt es bislang keine spezifischen Förderprogramme für forschende PAs, keine verbindlichen Karrierepfade im Hochschulsystem und keine strukturelle Anbindung von PA-Kompetenz an die medizinische Versorgungsforschung.
Dabei wäre das Potenzial enorm: Physician Assistants bringen aus ihrer klinischen Arbeit wertvolle Perspektiven mit, die für patientennahe Forschung, Versorgungsmodelle und Qualitätssicherung von hoher Relevanz sind. Gleichzeitig zeigen viele PA-Studierende ein hohes wissenschaftliches Interesse, doch ohne strukturelle Unterstützung bleibt dieses Potenzial meist ungenutzt.
Fazit: Möglich, aber nicht selbstverständlich
Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Promotion für Physician Assistants ist rechtlich möglich, aber in der Realität mit vielen Hürden verbunden. Es braucht nicht nur einen passenden Masterabschluss, sondern vor allem Zeit, institutionelle Unterstützung, wissenschaftliches Mentoring und eine gute Portion Glück. Wer diesen Weg gehen möchte, sollte sich frühzeitig um Netzwerke bemühen, sich über potenzielle Promotionsprogramme informieren und sich nicht entmutigen lassen, wenn es nicht sofort klappt.
Dennoch: Eine Selbstverständlichkeit ist die Promotion für PAs aktuell nicht, auch wenn es manchmal so klingt. Damit sich das ändert, braucht es neue Kooperationsmodelle, mehr Anerkennung wissenschaftlicher Kompetenzen im PA-Beruf und gezielte Programme, die forschungsinteressierte PAs fördern. Bis dahin bleibt die Promotion für viele eher ein Sonderweg als ein realistisches Karriereziel.